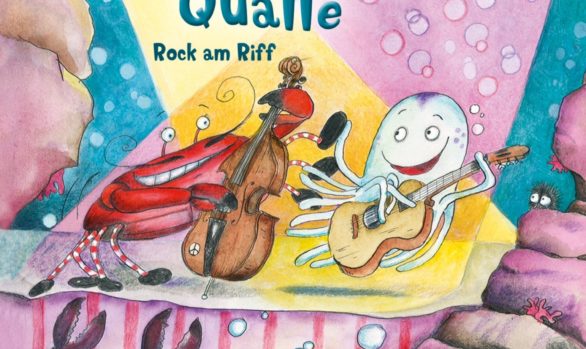Schöne Grüße vom Schicksal (2018)
AlbenSchicksal oder Zufall? Geht es um die alte, schon vor Jahrtausenden die besten Geister entzweiende Frage, hat Heinz Rudolf Kunze eine klare Präferenz: „Mir wäre schon deutlich wohler, wenn unser Dasein nicht nur blindem Zufall folgen würde. Ich hoffe auf einen Plan, der hinter allem steckt – auch wenn ich ihn natürlich nicht erkennen kann.“ Worüber der Mensch nicht zu verfügen vermag, dem er gleichwohl einen Sinn zuschreibt, das nennt er Schicksal. Ein Wort, wie von Albrecht Dürer in Kupfer gestochen, archaisch und schwer wie nur je eines. Doch Kunze wäre nicht Kunze, wenn er nicht auch diesen Begriff mit Leichtigkeit vom Kopf auf die Füße stellen, ins Getümmel schubsen und zum Tanzen bringen könnte. Das neue Album – Kunzes sechsunddreißigstes seit 1981 und das erste bei Electrola / Universal Music – richtet Schöne Grüße vom Schicksal aus, fünfzehn sind es insgesamt. Songs, die von Schicksalsergebenheit ebenso erzählen wie von unbeugsamen Trotz; von den Schlägen, die man nicht kommen sieht, wie von den Momenten, in denen alles perfekt ist und einem die List der Vernunft ein Lächeln schenkt. Kurz: Musik für die beste aller möglichen Welten. Mindestens.
„Ich war lange verborgen, / hab mir Menschen ausgedacht, / alles, was sie erleben, / selbst mit durchgemacht“, singt Kunze im Opener „Raus auf die Straße“. In diesen Zeilen steckt eine ganze Poetik. Denn vor die Wahl zwischen Dichtung und Wahrheit gestellt, wählt Kunze stets – beides. Er behelligt den Hörer nicht mit seinem Leben. Er hebt auch nicht den Zeigefinger. Viel lieber teilt er Beobachtungen, entwirft Geschichten und stellt Bilder hin, die der Welt zu ein wenig mehr Kenntlichkeit verhelfen können. Hunderte von Texten standen für dieses Album zur Auswahl, um erst von Musik zum Leben erweckt und dann schließlich vor die Leute gebracht zu werden, ins Radio, auf die Kopfhörer, in die Hallen. Stilecht mit Springsteen-Klavier feiert „Raus auf die Straße“ den Aufbruch und die auch nach all den Jahren noch immer andauernde Liebe zwischen dem Sänger und seinem Publikum. Es ist die ideale Eröffnungsnummer für ein Album, auf dem so vieles in Bewegung gerät: die Menschen, die Gedanken und Erinnerungen, die musikalischen Stile.
In „Komm mit mir“ hakt sich ein Taugenichts bei Ray Charles und Van Morrison unter und geht, vergnügt „Hit the Road, Jack“ pfeifend, mit ihnen die Straße runter und auch wieder rauf. In „Ich sag’s dir gerne tausendmal“ werden Treppen übersprungen, Gipfel gestürmt und Hängematten zwischen Wolken aufgespannt. Die Musik dazu ist, wie sie sein soll: schimmernder Pop, eingängig und himmelblau. „Luft nach oben“ vollführt seine Freudensprünge erst als Reminiszenz an die Neue Deutsche Welle, zu deren Blütezeit Kunze seine Karriere einst begann, um dann den Refrain im Glamour der frühen Roxy Music explodieren zu lassen. Und die von der Wiege bis zur Bahre reichende, so leidenschaftliche wie vergebliche Suche nach Ankommen und Erfüllung, von der „Immerzu fehlt was“ handelt, findet ihre Entsprechung in einer Verbeugung vor dem Groove und der Vitalität schwarzer Musik.
Und wie gut Kunze singt! Vielleicht so gut wie noch nie. Es ist, als hätte er in den vielen Solo-Auftritten der vergangenen Jahre seine Stimme noch einmal ganz neu als Instrument entdeckt, mit dem er nun – Orpheus mit Brille – vom beschädigten, vom wunderbaren Leben erzählen und das Schicksal zum Duell herausfordern kann. Er singt aus voller Kehle und wie der junge Mann, der er einmal war. Nur besser. Er jubelt und seufzt und verdammt und bringt der Welt mit „Schäme dich nicht deiner Tränen“ ein großes Abschiedslied, das von Vergänglichkeit spricht und vom Vorsatz, die köstliche Zeit, die noch da ist, bis zur Neige auszutrinken.
Denn noch immer gilt: Was bleibet aber, stiften die Dichter – und sei‘s die Furcht, dass gerade nichts von dem, was jetzt noch Bestand hat, bleiben wird. Auch davon legt Kunze auf diesem Album Zeugnis ab. Etwa im schmerzlich-schönen Winterbild „Der Vogel, der nach Süden zieht“, das im 9/8-Takt des Jazzrock fast schon ins Jenseitige kreiselt, dorthin, wo sich nicht mehr entscheiden lässt, ob der Rauch, der in den leeren, weißen Himmel aufsteigt, von einem Freudenfeuer stammt oder von den Flammen, die allem ein Ende machen. Die zehn Strophen von „Herzschlagfinale“ wissen ebenfalls um den oft heillosen Lauf der Dinge, aber auch, wie er sich, zumindest manchmal, aufhalten lässt: durch den Blick auf ein geliebtes Gesicht, auf das das Licht gemeinsam verbrachter Jahre fällt. Ganz Ratlosigkeit und Angst ist schließlich „Wie tut man denn sowas?“. Angesichts von religiös motivierten Terroranschlägen; angesichts von Tätern, die ihren Sieg gar nicht erleben wollen, gibt es keine Antworten mehr, sondern nur noch Fragen, die fassungslos auf den Umschlag von Vernunft in Barbarei deuten. Kunze kleidet sie in die Unerbittlichkeit einer alten Folk-Ballade.
Doch das Album lässt den Hörer nicht resigniert zurück. Im Gegenteil. Es zeigt die Lücke, die das Schicksal lässt und flutet sie mit desperater Lebensfreude: „Also reicht euch die Hände, / beschmiert Tisch und Wände / und schmettert vergebliche Lieder“. Im Saloon der alten „Zitadelle“, Kunzes Trutzburg gegen Oberflächlichkeit und Herden-Mentalität, spielt noch ein Honky-Tonk-Klavier. Und „Schorsch, genannt die Schere“, eine Kreuzung aus Robin Hood und Charles Manson, stattet den Prominenten sowie denen, die sich dafür halten, in ihren Luxusvierteln einen unangemeldeten (und schmerzhaften) Besuch ab.
Dagegen stehen die „ganz normalen Menschen“. Mit ihrer Ehrenrettung endet die Platte. Sie erhebt das Glas auf die, die im Dunkel des gelebten Augenblicks tun, was sie können, und nimmt sie in Schutz gegen ihre leider viel zu normal gewordene Vereinnahmung durch Populisten. Näher an eine Hymne heran ist Heinz Rudolf Kunze auch musikalisch selten gekommen. Eine Hymne indes, die nicht überhöht, sondern dem Alltäglichen ein lang schon überfälliges Denkmal setzt.